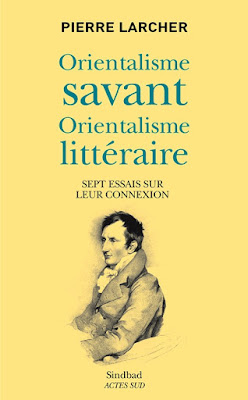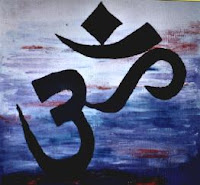|
| Der Mythos: Zeus entführt Europa (2 Euro-Münze Griechenland) Zur Bedeutung des Stiers in der Mythologie |
Der Orient ist Europas Schicksal
von Konstantin Sakkas
Er betont die kulturelle Einheit, die schon Goethe im West-östlichen Divan betonte. Zugleich erinnert er daran, dass der heutige Anti-Islamismus nur eine moderne Spielart eines Jahrhunderte lang gepflegten Anti-Orientalismus ist.
"Europa und der Orient bilden seit Urzeiten eine geistige und kulturelle Einheit. Wenn Europa nicht ein entsprechendes geopolitisches Narrativ entwickelt und in praktische Politik umsetzt, wird es untergehen.Der heutige Antiislamismus ist nichts anderes als die moderne Spielart des Antiorientalismus. Über Jahrhunderte hinweg richtete sich dieser Antiorientalismus in Europa gegen die Juden, mit Abstrichen auch gegen die Griechen. An ihre Stelle sind heute "die Moslems" getreten, und in ganz Europa sind antimuslimische Bewegungen auf dem Vormarsch.Doch mit dem Antiorientalismus schießt sich Europa ins eigene Knie. Denn Europa und der Orient bilden seit Urzeiten eine geistige und kulturelle Einheit. Der Gegenentwurf hierzu war das Konzept der "Westernness", also eines westlichen, atlantischen Europas, das sich vom vermeintlich minderwertigen Orient hermetisch abschottet – ein ebenso uraltes Konzept, das aber bis heute nicht aufgegangen ist."
 |
| "Europa greift nach den Sternen", Skulptur von Helmut Lutz Münsterplatz Breisach (Wikipedia) |
Aber die europäische Geschichte zeigt zum Glück auch freundliche Tendenzen interkultureller Begegnung. Diese müssen wieder stärker ins Bewusstsein rücken. Goethe bietet dazu ermutigende Anleitungen:
Wer sich selbst und andre kennt,
Wird auch hier erkennen:
Orient und Occident
Sind nicht mehr zu trennen:
Sinnig zwischen beiden Welten.
Sich zu wiegen, lass ich gelten;
Also zwischen Ost und Westen
Sich bewegen, sei’s zum Besten.
Johann Wolfgang von Goethe,
West-östlicher Divan, Nachtrag, 1825/26
| Schumann-Adenauer-Gedenkzeichen 12 Stelen in Bassenheim: und Europa mit dem Stier (Wikipedia) |
der Skuptur und
in der (Garten-)Architektur
 |
| Potsdam: Wasserwerk im orientalischen Stil |
- Muttergottheiten - die sog. Matronenheiligtümer
im römischen Niedergermanien - Berühmtes Vorbild:
Granada: - Alhambra - Generalife - Moschee und Rokoko-Theater Schwetzingen
- Chinesisches Teehaus im Schlosspark
von Sanssouci (Potsdam) - Gärten der Welt in Berlin-Marzahn
- Museumspark Orientalis, Nijmegen (NL)
- Die Siebenschläfer von Ruhstorf:
Christlich-islamische Begegnungen - Gérard-Georges Lemaire:
Orientalismus. Das Bild des Morgenlandes in der Malerei.
Aus dem Französischen.
Potsdam: H.F. Ullmann 2010, 360 S,, Abb., Künstlerbiogarfien, Register - Gereon Sievernich / Hendrik Budde (Hg.):
Europa und der Orient. 800 - 1900.
Begleitbuch und Katalog zur Ausstellung vom 28.05. 27.08.1989:
4. Festival der Weltkulturen Horizonte '89. Berlin
Berliner Festspiele / Bertelsmann Lexikon Verlag:
Gütersloh/München 1989, 923 S., Abb., Index
Inhaltsverzeichnis: hier
--- mit Lesebuch. 1989, 138 S.
| Allegorische Darstellung des Kontinents Asien in orientalischem Ambiente Fresko in der Rokoko-Kirche Steinhausen |
Orient-Sympathien und Rezeptionen:Theater, Oper, Literatur
- Die Goldene Legende / Legenda Aurea - Geschichten von Orient und Okzident
- Die religionsgeschichtliche Bedeutung der Iberischen Halbinsel für den Trialog
- Schahname, das Königsbuch von Firdausi, persisches Nationalepos
- Die göttliche Komödie (Wikipedia) ---
und Johann Gottfried Herder (1744-1803)
- Nathan der Weise als Anregungsmuster für interreligiöses Lernen
- Johann Gottfried Herder und der Orient: Glaube als stille Spiritualität
Melanie Christina Mohr in Qantara.de vom 14.06.2017
- Voltaire (1742) und Goethe (1802) zu Mohammed:
Der Fanatismus oder Mohammed der Prophet ---
Correspondance Voltaire (abgerufen, 02.08.17)
- Johann Wolfgang von Goethe: West-östlicher Divan
(1814-1819) -
Texte zum Download: hier![]()
Goethe-Hafis-Denkmal in Weimar - Goethe, Hafis und
der west-östliche Divan
(Power Point) Präsentation) - Johann Wolfgang von Goethe:
Jochen Golz / Adrian Hsia (Hg.): Orient und Okzident zur Faustrezeptionin nicht-christlichen KulturenKöln u.a.: Böhlau 2008
>>>> Hermann Hesse
(1877-1962)
und Bertolt Brecht
(1898-1956):
(1877-1962)
und Bertolt Brecht
(1898-1956):
- Karl-Josef Kuschel:
Hermann Hesse und Bertolt Brechtim Dialog mit Buddha, Laotse und Zen.Ostfildern: Patmos,
März 2018, 712 S., Abb.
--- Inhaltsverzeichnis: hier
- Daniel Barenboim und das West-Eastern Divan Orchestra
- Georg Friedrich Händel: Musikalische Weltspiegelungen
im Werk eines großen Europäers - Antonio Vivaldi: Il Teuzzone
--- Der Kaiser von China (Mantua 1718) - Il Teuzzone: Aufführung im Gran Teatro de Liceu, Barcelona (2017)
-- Zum Nachhören (YouTube, 2011): hier - Turandot von Friedrich Schiller, Giacomo Puccini
--- Aufführungen: Seebühne Bregenz (2015/2016) --- Südwestpresse, 22.07.2016
Universität
- Liste der ältesten Universitäten (wikipedia)
- Mittelalterliche Studienfächer:Die 7 Freien Künste - Septem Artes liberales
- Rainer A. Müller: Geschichte der Universität.Von der mittelalterlichen Universitas zur deutschen Hochschule.Hamburg: Nikol 1996, 288 S., Abb.
- Karl-Heinrich Hansmeyer / Friedrich-Wilhelm Henning (Hg.): 600 Jahre Kölner Universität 1388/1988Reden und Berichte zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Universität.Köln: Wienand 1989, 411 S., Abb.
Kleine Literaturauswahl
Europa, Orient und Orientalismus
Europa, Orient und Orientalismus
- Forschungsmagazin der Universität Bamberg (Mai 2017):
Cover - Wagenbach-Verlag Berlin 2015
Rezensionsnotizen in Perlentaucher: hier
Europa erforschen - Europa gestalten (Download) - Reinhard Kirste / Paul Schwarzenau / Udo Tworuschka (Hg.):
Europa im Orient - der Orient in Europa.
Religionen im Gespräch Bd. 9 (RIG 9).
Balve: Zimmermann 2006, 528 S.
Ausführliche Besprechungen: hier - Heinrich Schmidinger (Hg.): Wege zur Toleranz
Geschichte einer europäischen Idee in Quellen.
Darmstadt: WBG 2002, 319 S.
Rezension von Alfons Brüning in "sehepunkte",
Ausgabe 3 (2003), Nr. 10: hier - Die Reformation - eine europäische Bewegung
- Die wirkungsgeschichtliche Bedeutung antiker Religion und Philosophie
- Aspekte zum Islam in Europa
- Islam und Aufklärung - Geschichte und Gegenwart
- Wege der Templer - ungewollte Brückenbauer zwischen Orient und Okzident
- Europa, die Johanniter und die Komturei in Nieder-Weisel
- Die Wirkungsgeschichte der Zisterzienser
- Europäische Etappen: Der Jakobsweg
- Der Rhein - Völker verbindend (Carl Zuckmayer)
- Die Siebenschläfer-Kirche in Ruhstorf: Einladung zum Dialog
- Die römische Antike, Judentum und Reformation in Worms
- Lernort für Europa: Schengen
- Valmy: Was hat eine Mühle mit Europa zu tun?
- Abdurrahman Al-Gabarti - aus der Chronik: Bonaparte in Ägypten.
Übersetzt von Arnold Hottinger.
SP 871. München / Zürich: Piper 1989, 450 S., Register - Al-Jabarti's Chronicle of the French Occupation.
1798. Napoleon in Egypt
Introduction: Robert L. Tignor, Translation: Shmuel Moreh.
Expanded edition in honor of Al-Jabart's 250th birthday.
Princeton (USA): Markus Wiener Publ. 2004, 210 pp., illustr. - Badisches Landesmuseum (Hg.):
Das Imperium der Götter.
Isis - Mithras - Christus.
Kulte und Religionen im Römischen Reich.
Darmstadt: Konrad Theiss (WBG) 2014, 580 S., Abb. , KartenNew York: W.W. Norton & Company 2017, 234 pp.
Verlagsinfo: hier - Anke Bentzin / Henner Fürtig / Thomas Krüppner /
Riem Spielhaus (Hg.):
Zwischen Orient und Okzident. Studien zu Mobilität von Wissen,
Konzepten und Praktiken. Festschrift für Peter Heine
Freiburg u.a.: Herder 2010, 365 S.
--- Rezension: hier - Dominiqu Chevallier / Azzedine Guellouz / André Miquel:
Les Arabes, l'Islam et l'Europe. Paris: Flammarion 1991m 234 pp., cartes
Kurzrezension: hier - von Belgourch Abderrahman, in:Politique étrangère Année 1991 Volume 56 Numéro 3 p. 758 - Henry Corbin: Weder Germanist, noch Orientalist
Marian Bremer in Qantara.de, 19.04.2017 - Nefvel Cumart / Ulrich Waas:
Orient und Okzident - die andere Geschichte. Das Fremde als kulturelle Bereicherung.
Buchreihe der Georges-Anawati-Stiftung, Bd. 14
Freiburg/Br. u.a.: Herder 2017, 240 S.
--- Rezension: hier
| Cover der Ausstellungsbände "Ex Oriente": Bagdad, Jerusalem, Aachen |
- DRESSEN, Wolfgang / MINKENBERG, Georg / OELLERS, Adam C. (Hg.):
EX ORIENTE: Isaak und der weiße Elephant. Bagdad-Jerusalem-Aachen. Eine Reise durch drei Kulturen um 800 und heute. Katalogbuch in drei Bänden zur Ausstellung in Rathaus,
Dom und Domschatzkammer Aachen vom 30.06.-28.09.2003
- Bd. I: Die Reise des Isaak. Bagdad. 287 S., Abb.
- Bd. II: Jerusalem. 143 S., Abb.
- Bd. III: Achen. Der Westen. 264 S., Abb.-
Kommentar zur Ausstellung 2003 in der ZEIT Nr. 28 03.07.2003)London: I.B. Tauris 2011, 256 pp., illustr.
Dag Nikolaus Hasse:Von Alkohol bis Ziffer - Der arabische Einfluss in Europa im Spiegel der deutschen Sprache. In: Dorothea Klein (Hg.):"Überall ist Mittelalter". Zur Aktualität einer vergangenen Epoche. Würzburg: Königshausen & Neumann 2015, S. 151-172 (mit Abb.)
- Götz Großklaus: Das Janusgesicht Europas.
Zur Kritik des kolonialen Diskurses
Bielefeld: Transcript 2017, 230 S., Abb. - Klaus-Werner Haupt:
Okzident & Orient.
Die Faszination des Orients im langen 19. Jahrhundert
Wiesbaden 2015, 246 S., Abb., PersonenregisterMünchen: C.H. Beck 2014, 368 S.
Rezension: SWR 2,15.09.2014: hier - Friedrich Heer: Karl der Große und seine Welt.
Wien u.a.: Molden 1977, 272 S., Abb., Karten - Walter Homolka: Von wegen Abendland --- Europa als das Ergebnis Jahrhundere tlanger Pluralisierung.
Sächsische Zeitung online, 18.10.2017 - Bichara Khader: ---- Europa y el mundo árabe.
Primos, vecinos. Agencia Espanola de Cooperación Internacional
1995. 277 pp. - Europa und der Orient 800 - 1900
[28. Mai - 27. August 1989 ;
eine Ausstellung des 4. Festivals der Weltkulturen Horizonte '89
im Martin-Gropius-Bau, Berlin].
Berliner Festspiele / Bertelsmann Lexikon Verlag 1989, 923 S., Abb. - Die Päpste und die Einheit der lateinischen Welt
Antike - Mittelalter - Renaissance
Ausstellung 21.05. - 31.10.2017 (Bildergalerie im Internet)
Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim - Annette Kuhn: Warum sitzt Europa auf dem Stier?
Matriarchale Grundlagen von Europa
in: Frauen verändern EUROPA verändert Frauen
Hg.: Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen, 2008 S. 191 - 201. - Pierre Larcher: Orientalismus des Westens
![]()
Pierre Larcher: Orientalismus des Westens
Arles (F): Sindbad/Actes Sud 2017, 240 pp. - Jacques Le Goff: Die Geburt Europas im Mittelalter.
Aus dem Französischen von Grete Osterwald.
Darmstadt: WBG 2004, 344 S., IndexRezension von Klaus Oschema in "sehepunkte": hier
(Ausgabe 4 (2004), Nr. 7/8 ) - Alain de Libéra:
Penser au Moyen Âge.
Paris: Seuil 1991, 413 pp., index - Pedro Martinez Montavo / Carmen Ruiz Bravo-Villasante:
Europa unter dem Halbmond. Eine illustrierte Kulturgeschichte. Übersetzung aus dem Spanischen / Englischen: Gerhard Hoffmann.
München: Südwest [1992] 2000, 239 S.,
Kritik am Text - gute Bilder: ZEIT online, 10.04.1992 - Joseph Needham: La science chinoise
et l'Occident (Le grand tirage)
Rezension in Perséeaus: Traduit de l'anglais par Euène Jacob). Paris: Seuil 1973, 267 pp. - Hanna Nohe: Fingierte Orientalen erschaffen Europa.
Zur Konstruktion kultureller Identitäten im Reisebrief-Roman der Aufklärung.
Paderborn: W. Fink 2018, 328 S. - Harry Olmeadow: Journeys East: 20th Century Western Encounters with Eastern Religious Traditions. Bloomington, Indiana (USA): World Wisdom Books 2004, 552 pp.
Details mit Inhaltsangabe und Leseproben: hier - Französische Ausgabe:
Harry Olmeadow: Vers l'Orient!
La rencontre des Occidentaux avec les traditions orientales au XXe siècle.
La Chapelle sous Aubenas (F): Hozhoni 2018, 660 pp. - Saddek Rabah: L'Islam dans l'imaginaire Occidental.
Aux sources des discours.
Beyrouth: Al Bouraq 1998, 241 pp. - David Talbot Rice: Morgen des Abendlandes.
Von der Antike zum MittelalterAusgabe: München / Zürich: Droemer und Knaur1965, 359 S., Abb., Karten, Register• Ausgabe der Reihe: Große Kulturen in Farbe.
Eltville/Rh.: Rheingauer 1986, 215 S., Abb., Register - Edward Said: --- L'Orientalisme.
L'Orient créé par l'Occident.
Aus dem Amerikanischen vonFrankfurt/M.: Fischer 2009, 464 S.
Cathérine Malamoud. Préface de Tzevetan Todorov.
Traduit de l´Américain par Cathérine Malamoud. Paris Seuil 1980, 393 S., Personenregister
--- Culture and Imperialism.
New York: Random House 1994, 380 S., Register
--- Zum Tod von Edward Said -
wirkungsmächtig und umstritten.
Jörg Lau in ZEIT online, 25.09.2003 - Andreas Schmauder / Jan-Friedrich Missfelder (Hg.): Religiöse Koexistenz im urbanen Raum
(15.-20. Jahrhundert.
Stadt in der Geschichte, Bd. 35. Ostfildern:
Thorbecke 2010, 340 S. - Gereon Sievernich / Hendrick Buddha (Hg.):
Lesebuch zu "Europa und der Orient 800 - 1900.
Berliner Festspiele 1989, 138 S. - Ziauddin Sardar: Orientalism. Concepts in Social Sciences. Buckingham:
Open University Press 1999, 136 pp., index
Deutsche Ausgabe: Der fremde Orient.
Geschichte eines Vorurteils.
Aus dem Englischen von Matthias Strobel.
Berlin: Klaus Wagenbach 2002, Wagenbach TB 451, 188 S., Personenregister - Alfred Schlicht: Geschichte der arabischen Welt.
Stuttgart: Reclam 2013, 400 S.
--- Rezension: hier
Alfred Schlicht: Ex Oriente Lux. Wissenstransfer zwischen Orient und Okzident -
Rotary Magazin, 01.12.2015 - Andreas Schmauder / Jan-Friedrich Missfelder (Hg.):
Religiöse Koexistenz im urbanen Raum
(15.-20. Jahrhundert).
Stadt in der Geschichte, Bd. 35. Ostfildern: Thorbecke (Schwabenverlag) 2010, 340 S.
Rezension von Görge Hasselhoff in "sehepunkte", Ausgabe 11 (2011), Nr. 04 - Burkhard Schnepel / Gunnar Brands / Hanne Schönig (Hg.):
Orient - Orientalistik - Orientalismus. Geschichte und Aktualität einer Debatte.
Postcolonial Studies Bd. 5.
Bielefeld: Transcript 2001, 310 S., Abb.
--- Inhaltsverzeichnis und Leseprobe: hier --- Rezension: hier - Christoph Stiegemann / Matthias Wemhoff (Hg.):
799. Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Karl der Große und Papst Leo III. in Paderborn.
Katalog und Handbuch zur Ausstellung Paderborn 1999. 3 Bände
Mainz: Philipp von Zabern 1999,
--- Bd. 1+2: Katalog der Ausstellung. XIV, S.1-417.418-938
--- Bd. 3: Handbuch zur Geschichte der Karolingerzeit.
Beiträge zum Katalog der Ausstellung. X, 744 S - Christoph Stiegemann: Ein Erlebnis von Gleichzeitigkeit
Zu den großen Mittelalterausstellungen in Paderborn seit 1999
(Diözesanmuseum Paderborn 1999, 2001, 206, 2010)
- Monika Walter: Der verschwundene Islam?
Für eine andere Kulturgeschichte Westeuropas.
Paderborn: Wilhelm Fink 2016, 533 S.
--- Rezension: hier - Stefan Weidner: Der verlorene Orient. ZEIT online, 19.10.2017 (4 S.)
- Ursula Wokoeck:
German Orientalism. The Study of the Middle East and Islam from 1800 to 1945.
London / New York: Routledge 2009, XV, 333 pp.
 |
| Stuttgart: Kohlhammer 2008, 226 S., Register --- Rezension "Ein-Sichten": hier Rezension im Portal fürPolitikwissenschaft: hier |