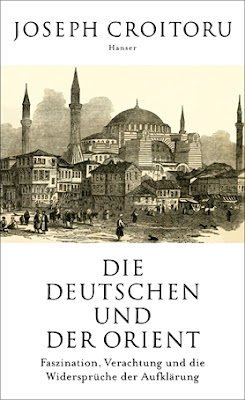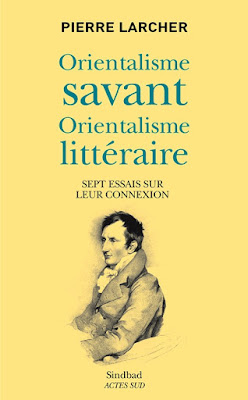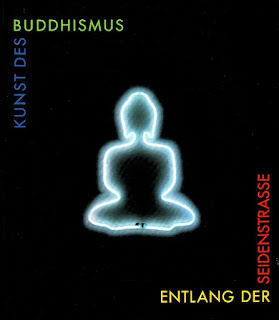| Abtei Sénanque, Provence (Wikipedia.fr) |
Die als Reformorden im Mittelalter entstandenen Zisterzienser haben binnen kurzer Zeit ein europäisches Netzwerk aufgebaut. Ihre Faszination und ihr Vermächtnis wirken bis in die Gegenwart.
- Landesmuseum Bonn (Hg.): Die Zisterzienser
Das Europa der Klöster. Darmstadt: Theiss (WBG) 2017, Abb., Glossar -
Begleitbuch zur Ausstellung, Sommer 2017 bis Januar 2018--- Rezension: hier (Buch des Monats August 2017)
- Details zur Ausstellung im Rheinischen Landesmuseum (LVR) Bonn
- Das Vermächtnis der Zisterzienser (arte TV)
- Das Ordens-Netzwerk der Zisterzienser.
Ein Bildkommentar zur Ausstellung - Übersicht zur Geschichte und den Regionen Europas (wikipedia)
- Abteien und Orte der Zisterzienser in Europa
(Charte européenne)
| Zisterzienserkirche Pontigny - bewusst ohne Turm |
Altenberger Dom, Westfenster |
Rezensionen
- Mehr zum Zisterzienerorden: hier
- Immo Eberl: Die Zisterzienser.
Geschichte eines europäischen Ordens.
Stuttgart: Thorbecke 2002, 616 S.
--- Neuauflage 2007: hier
Christoph Dartmann:
Die Benediktiner. Von den Anfängen
bis zum Ende des Mittelalters.
Urban-TB. Stuttgart: Kohlhammer 2017, 301 S., Abb.
Bernhard von Clairvaux
(1090 - 1153)
- Infos bei Wikipedia: hier
Mönchshabit
- Sandsteinskulptur
Abteikirche Marmoutier (Elsass) - Saint Bernard. La tradition vivante.
Ste. Maxime:
C.I-F. Editions 1990, 32 pp., illustr. - PAFFRATH, Arno: Bernhard von Clairvaux
2 Bände. Bergisch Gladbach:
Altenberger Domverein 1984--- Bd. 1: Leben und Wirken -
dargestellt in den Bilderzyklen
von Altenberg bis Zwettl. 448 S., Abb.--- Bd. 2: Die Darstellung des Heiligen
in der Bildenden Kunst.
222 S., Abb., biografische Daten
Gott in sich entdecken
Bernhard von Clairvaux -
faszinierend-polemischer Prediger
und Wundertäter
auch in Deutschland:
Bernhard ruft 1146/1147
geradezu fanatisch
zum 2. Kreuzzug auf (auch zum Slawenkreuzzug
und indirekt zu Judenpogromen) -
gegen die anfänglichen Bedenken von Kaiser Konrad III.
faszinierend-polemischer Prediger
und Wundertäter
auch in Deutschland:
Bernhard ruft 1146/1147
geradezu fanatisch
zum 2. Kreuzzug auf (auch zum Slawenkreuzzug
und indirekt zu Judenpogromen) -
gegen die anfänglichen Bedenken von Kaiser Konrad III.
>>> Rezension in der FAZ , 20.06.1997
zu Gerd Althoff: Spielregeln der Politik
zu Gerd Althoff: Spielregeln der Politik
im Mittelalter. Kommunikation in Friede und Fehde.
Darmstadt: Primus 1997, IX, 360 S.
Darmstadt: Primus 1997, IX, 360 S.
- Der Hl. Bernhard in Frankfurt/M.:Bericht in der FAZ, 07.10.2017,zur Frankfurter Buchmesse
Nr 233, Seite L3:
2017:
"In weiter Ferne so nah".
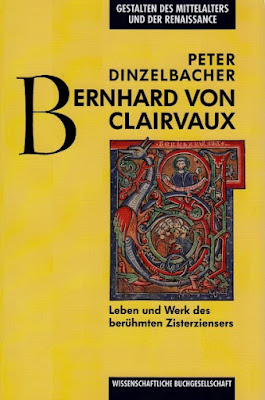
- Peter Dinzelbacher:
Bernhard von Clairvaux.Leben und Werk das berühmten Zisterziensers.Darmstadt: WBG [1998], 2012, 497 S.
Jean Leclercq:
Bernhard von Clairvaux.
Ein Mönch prägt seine ZeitMünchen u.a.:
Neue Stadt 2005 (Neuausgabe), 200 S.
Bernhard von Clairvaux.
Ein Mönch prägt seine ZeitMünchen u.a.:
Neue Stadt 2005 (Neuausgabe), 200 S.
| Bernhard von Clairvaux: Sämtliche Werke. Gesamtausgabe. Innsbruck-Wien: Tyrolia 2002 |
Weitere Literatur
- Franz-Karl Freiherr von Linden: Die Zisterzienser in Europa.
Reise zu den schönsten Stätten
mittelalterlicher Klosterkultur.
- Mariano Dell' Omo: Geschichte des abendländischen Mönchtums
vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
Das Charisma des hl. Benedikt zwischen dem 6. und 20.Jahrhundert.
St. Ottilien: EOS 2017, 744 S., Abb.
--- Informationen, Inhaltsverzeichnis und Leseprobe: hier - Alberich Martin Aldermatt OCist (Hg.):
Zisterzienserinnen und Zisterzienser. Lebensbilder aus dem Zisterzienserorden.
Freiburg (CH): Kanisius 1998, 211 S. - Zur Spiritualität der Zisterzienser (mit Trappisten)
Bücher von Bernardin Schellenberger, Thomas Merton und Bruno Fromme - Betrachtung am Beispiel der mittelalterlichen Klosteranlageder ehemaligen Zisterzienserabtei Maulbronn
(2011, 28 S., Abb.)
- Jean-Francois LeRoux-Dhuys / Henri Gaud:
Die Zisterzienser. Geschichte und Architektur.
Aus dem Französischen.
Potsdam: Ullmann 2013, 366 S., Abb. - Jens Rüffer: Die Zisterzienser und ihre Klöster.
Leben und Bauen für Gott. - --- Weitere Literatur zu den Zisterziensern: hier
| Ehem. Abtei Royaumont zugleich Cover des Buches von F. LeRoux/H. Gaud |
| Ehemaliges Zisterzienserkloster Eberbach, Rheingau |
Zisterzienserklöster in Europa: Länderauswahl
--- Deutschland --- Österreich --- Schweiz --- Frankreich
--- Grossbritannien --- Irland --- Spanien --- Portugal --- Italien
Zisterzienser-Literatur im Klosterladen Eberbach, Vgl.: u.a.: --- Ralf Frenzel (Hg.): Kloster Eberbach. Geschichte und Wein. Wiesbaden: Tre Torri 2015, 240 S., Abb. --- Sebastian Koch: Kloster Eberbach im Nationalsozialismus. Hg: Stiftung Kloster Eberbach. Frankfurt/M.: Brandes & Apsel 2019, 312 S. |
DEUTSCHLAND
- Übersicht: hier
- Abtei Altenberg: Geschichte mit Literaturhinweisen (Wikiwand)
- Ehem. Zisterzienserkloster Marienrode (Hildesheim)
- Ehem. Zisterzienserinnenkloster Haydau (Nordhessen)
 |
| Stift Heiligenkreuz bei Wien |
ÖSTERREICH
FRANKREICH
SCHWEIZ
- Zisterzienser inistorischen Lexikon der Schweiz
- Abbaye de Hauterive bei Freiburg/Fribourg(Homepage)
- Liste der Zisterzienserklöster in Frankreich (wikipedia.fr)
- Abbayes Cisterciennes. Année Saint Bernard 1090 - 1990.
Paris: Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites 1990 - Zisterzienser-Abtei Notre Dame d'Acey: Kraftort der Stille
- Le Collège des Bernardins, Paris
- M.-Anselme Dimier / Jean Porcher:
Die Kunst der Zisterzienser in Frankreich.Aus dem Französischen von Gisela Umenhof und Karl Kolb.Würzburg: Zodiaque-Echter 1968, 367 S., Glossar, Abb.
| Ehem. Zisterzienserkloster La Chalade (Meuse / Maas) |
Pauline de Préval:
Une saison au Thoronet.
Carnets spirituels
Paris: Seuil 2015, 208 S.
--- Verlagsinfo: hier
--- Besprechung: hier
Pauline de Préval:
Une saison au Thoronet.
Carnets spirituels
Paris: Seuil 2015, 208 S.
--- Verlagsinfo: hier
--- Besprechung: hier
Julie Roux (réd.): Les Cisterciens.
Vic-en-Bigorre: MSM 1998, 2005, 225 S., Abb.
Das zisterziensische Abenteuer beginnt im Jahre 1098, als Robert von Molesme und Stephan Harding - angeregt durch den Willen zu einer Rückkehr zur Regel des Hl. Benedikt - einen Ort namens Cistels/Cîteauxgründen. Das ist ihr neues Kloster. Mit Bernhard von Clairvaux vervielfachen sich die Klostergründungen des Ordens von Cîteaux. Von den religiös und politisch Mächtigen geschätzt sind sie zugleich große Organisatoren. Man nennt sie auch aufgrund ihres Habits: Die weißen Mönche. Sie prägen eine ursptüngliche mystische Theologie und eröffnen neue Wege für die Kunst und Architektur durch die Betonung der Einfachheit. Noch heute schreiben die Nachfahren der Ordensgründer, die Mitglieder der großen zisterzensischen Familie diese Geschichte weiter.
Le Collège des Bernardins: Refektorium, Teil der ehemaligen Zisterzienser-Universität in Paris: Details: hier |

Préface: André Vingt-Trois
Préface: André Vingt-Trois
GROSSBRITANNIEN
- Liste der Zisterzienserklöster: hier
- Journal of the British Archeologigal Association, Vol. 159 for 2006, 344 pp., illust.
The Medieval Cloisters in England and Wales
Inhaltsverzeichnis und Leseprobe: hier
- William F. Pollard / Robert Boenig (eds.):
Mysticism and Spiritualiy in Medieval England.
Cambridge (UK): Brewer 1997, XI, 260 pp., index - Lionel Butler & Chris Given-Wilson:
Medieval Monasteries of Great Britain
London: Michael Josepj 1979, 416 pp., illustr., index - Gordon Mursell: English Spirituality. From Earliest Times to 1700.
Louisville et al.: Westminster John Knox Press 2001, XI, 584 pp., index - David H. Williams: The Welsh Cistercians
Written to Commemorate the Centenary of the Death of Stephen William Williams (1837-1899) - (The Father of Cistercian Archeology in Wales.
Leominster, Herefordshire (UK): Gracewing 2001, IX, 339 pp., illustr., indices - Aelred of Rivaulx: Spiritual Friendship
Cistercien Fathers Series, Number Five
Translated by Lawrence C. Braceland, sj Edited and Introduction by Marsha L. Dutton
Cistercian Publications / LITURGICAL PRESS Collegeville, Minnesota 2010, 159 pp.
Download der Einleitung und des 1. Buches: hier - Aelred von Rievaulx: Über spirituelle Freundschaft. Hg.: Wolfgang Buchmüller OCist, Übers: Moses Hamm OCist.
St. Ottilien: EOS 2018, 197 S., Anhang mit Bibliografien und Personenregister
Rezension: hier
 |
| Rievaulx Abbey, North Yorkshire (Wikipedia.en) |
 |
| Byland Abbey (wikipedia.en) |
 |
| Fountains Abbey (wikipeda.en) |
IRLAND
- (Ehemalige) Zisterzienserklöster in Irland (Wikipedia-Übersicht)
- Peter O'Dwyer, O Carm: Towards a History of Irish Spirituality.
Dublin: Columba Press 1995, 288 pp., indices
SPANIEN
- Die Zisterzienserroute durch Katalonien(Katalonien Tourismus)
- Die Route der Zisterzienserklöster (spain.info, abgerufen 07.02.2019)
| Kloster Santa María de Huerta im Süden der Provinz Soria in Kastilien-León an der Grenze zu Aragonien (Wikipedia) |
PORTUGAL
- Zisterzienserabteien in Portugal(wilkmedia Commons)
- Zisterzienserklöster in Italien
(wikipedia) - Abazio Santa Maria de Follina
(Comune di Follina)
 |
| Kreuzgang: Abazio Follina |