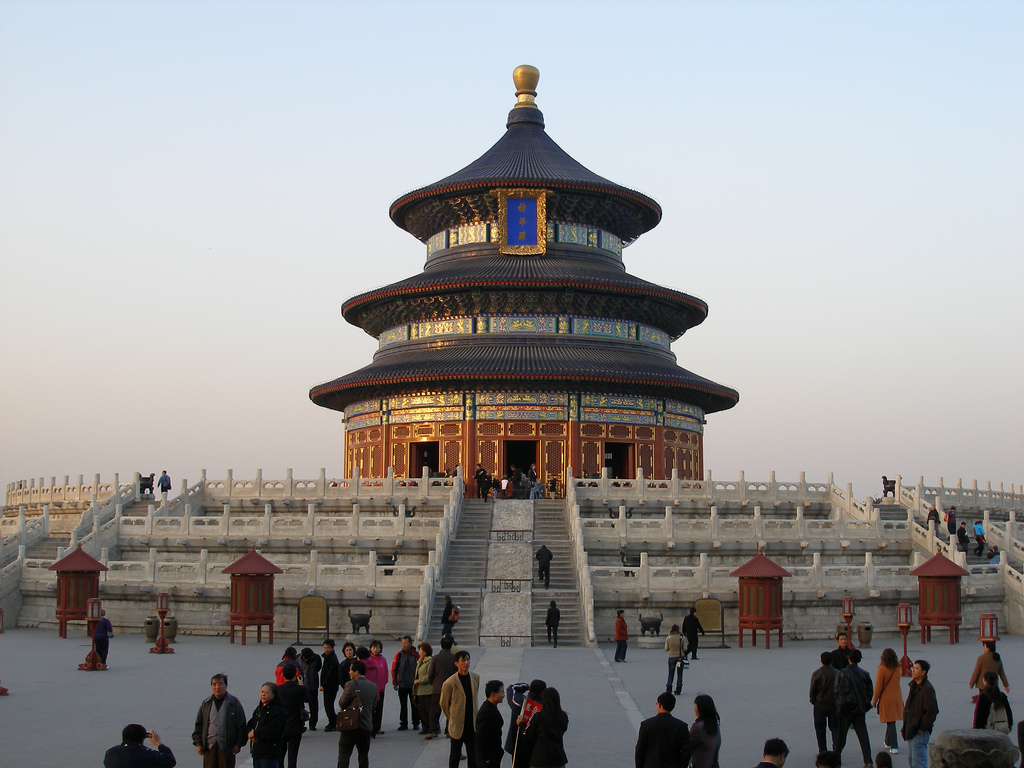![]() |
Kalligrafie - Bismillah: Im Namen Gottes, des Gnädigen und Barmherzigen -
und ein Koranvers rechts |
Ursprünglich Seminar für Lehramtsstudierende an der TU Dortmund (WiSe 2013-2014),
inzwischen erweiterte und kommentierte Materialsammlung.
------------------------------------------------------------------------Materialzusammenstellung
I. Themenstruktur: 1. - 15. Quellen, Geschichte, Dialog, ModerneII. Ergänzende Materialsammlung (mit Literatur)
III. Weitere (aktuelle) Literatur
-----------------------------------------------------------------------
1. Islam in Geschichte und Gegenwart
2. Koran-Übersetzungen und Interpretationen
![]()
I. THEMENSTRUKTUR
1. Gottesverständnisse (Monotheismus)
2. Quellen des GlaubensGottes ist der Westen und der Osten; wohin ihr euch immer wendet,
dort ist Gottes Angesicht (Sure 2,109).Annemarie Schimmel: Dein Wille geschehe, aaO S. 71
3. Glaube, Riten, Recht, Djihad,
Krieg und Frieden
4. Sunniten, Schiiten, Ibaditen, Feste im IslamWas Gott vor dir verhüllt, ist Seine übergroße Nähe zu dir.
Denn Er verhüllt sich durch seine allzugroße Klarheit
und verbirgt sich den Augen durch Sein allzustarkes Licht.Ibn Ata Allah (13. Jh.): Bedrängnisse sind Teppiche voller Gnaden.
Übersetzt und eingeleitet von Annemarie Schimmel.
Freiburg/Br.: Herder TB 1508, 1987, S. 72
- Annemarie Schimmel: Der Islam. Eine Einführung (s.u.), S. 82-90
- Informationen zu Sunna und Schia(Referat)
- Der tragische Märtyrertod des Imam Hussein,
überliefert von Abu Michnaf, Übersetzt von Heinrich F. Wüstenfeld,
korrigiert und Hg.: Hamid Reza Yousefi
Würzburg: Königshausen & Neumann 2017, 208 S.
Rezension >>> - Al-Abbas ibn Ali - Holy Shrine - Kerbela ---
sein Halbbruder: al-Husain ibn ʿAlī (Hussein)
Al-Abbas neben Abdullah ibn Ali, Dschaʿfar ibn Ali,
und ʿUthman ibn Ali = Söhne des Ali ibn Abi Talib, Schwiegersohn und Cousin des Propheten Mohammed
- Ergänzende Literatur:
--- Heinz Halm: Die Schia. Darmstadt: WBG 1988
--- Yann Richard: Die Geschichte der Schia im Islam.
Grundlagen einer Religion.
Aus dem Französischen von Beate Seel. Berlin: Wagenbach 1983 - Studies on Ibadism an Oman
Eds.: Abdulrahman Al Salimi and Ersilia Francesca
Hildesheim u.a.: Olms, bisher 19 Bände - Zwischen Sunna und Schia - der Ibadismus
(Le Monde des Religions, 26.04.2016)
5. Mohammed und der Beginn der islamischen GeschichteMeditation ist die Reise des Herzens
in den weiten Feldern der Andersheiten.
Meditation ist die Leuchte des Herzens;
wenn sie verschwindet,
ist das Herz nicht mehr erhellt. Ibn Ata Allah, aaO, S. 95
- Lektüre - Annemarie Schimmel, aaO, S. 12-19
- Alternative: Was jeder vom Islam wissen muss (s.u.), S. 25-36
![]() |
| Kalligrafien: Mohammed, Allah und die 4 Kalifen |
- --- Thematisches Protokoll
- Carlos A. Segovia: The Quranic Noah
and the Making of a Prophet.
Berlin: De Gruyter 2015, XVI, 154 pp.
--- Verlagsinfo + kommentiertes Inhaltsverzeichnis: hier - Arabien in der Antike und die Anfänge des Islam
- Mohammeds Kampf gegen die alten Götter,
630 n. Chr.
(WDR 01.11.2010) - Mohammeds Bruch mit den Juden in Medina (11.02.624)
(Hérodote.net, 11.02.2018) - Glen W. Bowersock: Die Wiege des Islams.
München: C.H. Beck 2019, 160 S., Illustr.
-- Verlagsinfo, Inhaltsverzeichnis, Leseprobe: hier
-- Rezension in Spektrum.de, 20.03.2019 - --- Héla Ouardi: Les derniers jours de Muhammad
Paris: Albin Michel, 2016 // Poche, 2017, 368 pp.
Enki Baptiste: Rezension in REMMM No. 144. novembre 2018
Extrait: Médine, juin 632. Sous le soleil accablant de l’Arabie, le temps semble s’être arrêté : le Prophète de l’islam a rendu son dernier souffle. Autour de lui, les fidèles de la nouvelle religion, plongés dans la sidération, tremblent à l’idée que la fin du monde soit proche. Mais où sont passés ses Compagnons ... Lire la suite / weiter ... - --- Héla Ouardi: Les Califes maudits: La déchirure » (premier tome)
Paris: Albin Michel 2019, 240 pp.
- of the Prophet of Islam from the Middle Ages to Today
Princeton University Press 2019, 328 pp., index, illustr.
- Arabien vor dem Islam -Annie Caubet:
Aux sources du Monde Arabe. L'Arabie avant l'Islam.
Collection du Musée du Louvre
Paris: IMA & Réunion des musées nationaux 1999 - Die Göttinnen von Mekka in vorislamischer Zeit
- Orientierung an den Zeittafeln (s.u.)
6. Brennpunkte islamischer Geschichte (1. Teil)Jedes Wort, das hinausgeht,
trägt das Gewand des Herzens, aus welchem es kommt. Ibn Ata Allah, aaO, S. 76
Monika und Udo Tworuschka: Illustrierte Geschichte des Islam
Berlin: Metzler 2017, 176 S., Abb.Lektüre Aufgaben:
--- Annemarie Schimmel, aaO, S. 12-13.20-27
--- Was jeder vom Islam wissen muss, S. 261-275- Die Bundessschlüsse des Propheten Mohammed
und islamischer Herrscher mit den Christen der Welt (englisch) - Mohammed und der Vertrag von Medina (aus ICT 18)
- Geschichte 1. Teil: 7. - 13. Jahrhundert(Protokoll)
- Der 4. Kreuzzug gerät auf Abwege:
Die Einnahme von Konstantinopel 12.04.1204
(Teilrezension zu: Michel Clévenot: Im Herzen des Mittelalters.
Geschichte des Christentums im XII. und XIII. Jahrhundert. Luzern: Ed. Exodus 1992 - Die Kreuzzüge aus islamischer Sicht
--- Paul Cobb: Der Kampf ums Paradies(2014)
--- Francesco Gabrieli: Arab Historians of the Crusades.
Selected and translated from the Arabic Sources. New York: Dorset 1989
--- Amin Maalouf: Der Heilige Krieg der Barbaren.
Die Kreuzzüge aus der Sicht der Araber. München Diederichs 1996
Rezension in "Der Humanist" (abgerufen, 25.03.2015)
--- Usama ibn Munqidh: Ein Leben im Kampf
gegen Kreuzritterheere [1982], Goldmann TB 1988
-- Kommentar in ZMS-Working-Paper Nr. 9:
Akkulturation und Identität(e) jenseits des Mittelmeers
--- Il ya 900 ans à Jérusalem. Chrétiens - Musulmans: le Choc
mit Dossier: La croisade vue par les musulmans.
Historia No. 630 (Juin 1999), bes. S. 35-61
--- Elif Gömleksiz: Kreuzzüge aus muslimischer Sicht.
Die Darstellung der "Franken" in Usama ibn Munqids Kitab al- I'tibar
Zeitschrift fir Islamische Studien (ZIS), 1. Jg. Heft 1 (April 2011), S. 44-54
--- Malcolm Cameron Lyons / D.E.P. Jackson: Saladin. The Politics Of The Holy War.
Cambridge (UK) u.a. / New York (USA ) u.a.:
Cambridge University Press [1982] 1986, VIII, 456 pp., index - Juden und Muslime - so nah und doch so fern
(Besprechung der ARTE-Dokumentation, Teil 1 und 2) - Martin Luther zum Islam.
Ein frühneuzeitlicher Beitrag zur Toleranzdiskussion
(Marcus Meer, Universität Bielefeld 013) - Zeittafel zur islamischen Geschichte
- theologisch, philosophisch, naturwissenschaftlich, politisch - Weitere Zeittafeln
- Zeittafel islamischer Geschichte von Adam bis zum Mittelalter
- Islamisches Erbe im Mittelmeerraum (Zeitreisen)
7. Brennpunkte islamischer Geschichte (2. Teil)
bis hin zum Arabischen Frühling Das Rad des Universums, in welchem wir uns drehen,
gleicht einer magischen Laterne.
Die Sonne ist die Leuchte,
die Welt der Bildschirm.
Und wir - die Bilder, die vorbeiziehen.
Omar Khayyam, Iran (1048-1131), Rubaijat ( = Vierzeiler) Nr. 44 Aus: Jean Vernette: Paraboles d'Orient et d'Occident.
Paris: Droguet et Ardant [1993] 2002, S. 162 (eig. Übers.)
Lektüre:
--- Annemarie Schimmel, aaO, S. 20-27 (Wiederholung), S. 114-130
--- Was jeder vom Islam wissen muss, S. 172-189
8. Brennpunkte islamischer Geschichte (3. Teil) -
Mittelmeerraum und Arabische Welt Es gibt kein Leben ohne Tod; ich bring mich wieder ein.
Ich möchte wieder widersteh'n und weiterhin verwundbar sein.
9. Islamische Geschichte in Deutschland (4. Teil) Was können wir gewinnen, wenn wir zum Mond fahren,
und es nicht schaffen, den Abgrund in uns selbst zu überqueren?
Das ist die wichtigste Reise in unserem Leben.
Lektüre:
--- Annemarie Schimmel, aaO, S. 125-130
--- Was jeder vom Islam wissen muss, S. 203-217 10. Islamische Geschichte (5. Teil)undSufismusDas Fenster der Verwundbarkeit ist ein Fenster zum Himmel.
Das Buch (Bibel, Koran, Bhagavadgita, Tao Te King)
hilft nur, das Fenster offen zu halten
nach Dorothee Sölle (1929-2003) Lektüre:
--- Annemarie Schimmel, aaO, S. 125-130 (Wiederholung), Neu: S. 91-114
--- Was jeder vom Islam wissen muss, S. 203-217 (Wiederholung), Neu: S. 122-13111. Islamische Geschichte:
Sufismus und Sonderformen des Islam
Mutaziliten, Wahabiten, Salafisten,
Alawiten, Aleviten, Ahmadiyya, Drusen, Baha'i, Yeziden Die Gottes-Erkenntnis kann man nicht durch Suchen erlangen,
aber nur die Suchenden erlangen sie.
Bayezid Bastami (Bistami), 803-875, persischer Mystiker
aus: Hossein Kazemzadeh-Iranschähr (Hg.):
Leben und Sprüche der Sufi-Meister des Islam. Berlin: Dagyeli 2005, S. 174
Lektüre:
--- Annemarie Schimmel, aaO, S. 117-130 --- Was jeder vom Islam wissen muss, S. 132- 1391. SUFISMUS Diese irdische Welt ist eine Karawanserei auf dem Wege zu Gott,
und alle Menschen finden sich in ihr als Reisegenossen zusammen.
Da sie aber alle nach demselben Ziel wandern und gleichsam eine Karawane bilden,
so müssen sie Frieden und Eintracht miteinander halten und einander helfen
und ein jeder die Rechte des andern achten.
- Was ist ein Sufi-Orden? (Französisch - YouTube)
- 10 clés por comprendre le soufisme
--- (10 Schlüssel, um den Sufismus zu verstehen) - TEL QUEL, 19.10.2015 - Der Alawiyya-Orden (AISA) in Frankreich und Deutschland
- Connaissance des Religions, No. 53-54 (janvier - juin 1998), 282 pp.:
Dossier: Lumières spirituelles de l'Islam - Islamische Mystik - ein Thema für den Religionsunterricht?
- Islamische Mystik / Sufismus: Literaturvorstellung
- Ibn Ata Allah und Al-Halladsch: Begegnungen mit islamischer Mystik
- Fariduddin Attar, Vogelgespräche und andere klassische Texte
- vorgestellt von Annemarie Schimmel. München: C.H. Beck 1999, 357 S.
Rezension in "Perlentaucher.de" - Farid-ud-Din Attar: Aphorismen
Attar: Das Buch der Leiden.Aus dem Persischen von Bernhard Meyer.
Mit einer Einführung von Monika Gronke.
Reihe: Orientalische Bibliothek. München: C.H. Beck (Sept. 2016), 350 S.
Attar ist einer der größten islamischen Mystiker. Das „Buch der Leiden“ stand lange im Schatten seiner „Vogelgespräche“, aber gerade in seiner Düsterheit liegt auch die Modernität dieser „vielleicht schwärzesten Dichtung, die je von einem Menschen geschrieben worden ist“ (Navid Kermani). Bernhard Meyer hat den Hauptteil des verstörenden Werkes erstmals vollständig ins Deutsche übertragen.
Der klassische persische Dichter ‘Attar (um 1136–1220) erzählt eine Seelenreise durch den Kosmos in vierzig Stationen. Der Wanderer bricht auf, um Erlösung von seinem Leiden zu finden, aber alle, die er um Hilfe bittet – die Erzengel, Paradies und Hölle, die vier Elemente, Satan, Dschinnen, Menschen und die Propheten von Adam bis Jesus –, schildern ihm nur ihr eigenes, viel schlimmeres Leiden. Erst Mohammed gibt ihm den Rat, nicht länger in der Welt zu suchen, sondern in sich selbst, und so versinkt er im „Meer der Seele“. Um diese Rahmenerzählung mäandern zahlreiche Geschichten, die das „Buch der Leiden“ trotz seiner Düsternis zu einer kurzweiligen Lektüre machen. Bernhard Meyer hat die 6200 Doppelverse in Prosa übertragen und mit erläuternden Anmerkungen versehen. Monika Gronke führt kundig in den Autor und seine Dichtung ein und erleichtert damit das Verständnis dieses einzigartigen Werkes der Weltliteratur.
- Claude Addas: Ibn Arabî et le voyage sans retour. Paris: Seuil 2015
Ausführliche Rezension: hier - Ibn Arabi-Society: Ibn Arabi (1165-1240) - Leben - Werk - Wirkung (englisch)
- Ibn al-FARID: Der Diwan. Mystische Poesie aus dem 13. Jahrhundert (2012)
- Hajo Bergmann: Das Fest der Derwische.
Unterwegs zu den Wurzeln islamischer Mystik.
Mit einem Vorwort von Annemarie Schimmel.
München: National Geographic (Goldmann TB 71197), 2003 - Mystik und Politik: Abd el-Kader (1808-1883)
- Maulana (Mevlana) Dschelaledddin RUMI
Annemarie Schimmel: Rumi. Ich bin Wind und du bist Feuer.
Leben und Werk des großen Mystikers. DG 20.
Köln: Eugen Diederichs 1986, 5. Aufl. u.ö., 232 S., Register
--- Roland Pietsch: Die Mystik Rumis im Werk von Annemarie Schimmel,
Spektrum Iran, 12 S. (abgerufen 06.05.2016) - Annemarie Schimmel: Dein Wille geschehe.
Die schönsten islamischen Gebete. Bonndorf: Turban 1992 - Seyyed Hosein NASR: Sufismo vivo [Lebendiger Sufismus]. Barcelona: Herder 2015, 248 p.
-------------------------------------------------------------------------------------------
2. Weitere islamische Richtungen
12. Islam in Schulbüchern und im UnterrichtVom Kreis aus unsrem Kommen und Gehn
Hat niemand noch Anfang und Ende gesehn.
Noch niemand sprach zu der Frage wahr,
Woher wir kommen, wohin wir gehn.
Omar Khayyam, Iran (1048-1131), Rubaijat ( = Vierzeiler) Nr. 3Hg.: Manuel Sommer. Wiesbaden: Pressler 1974, S. 41
13. Islam-Unterrichtsmaterial
Gemeinsame Traditionen in Bibel und Koran,
die Propheten, Mohammed und Jesus Die Seele steht so recht in der Mitte zwischen Zeit und Ewigkeit
Aus: Geduld bringt Frieden. Mystische Losung für jeden Tag ...
Frankfurt/M.: Insel 1994 (6.3.)
Vorlesung von Prof. Antes, Hannover, auf YouTube (2 Teile):
BIBEL UND KORAN IM VERGLEICHhttp://www.youtube.com/watch?v=IprVKE3DrsQ
http://www.youtube.com/watch?v=rBeScB6DePc
--- Lektüre:
- Annemarie Schimmel, aaO, S. 73-82 - Was jeder vom Islam wissen muss, S. 220-259AT: Noah, Abraham, MoseNT: Maria, Jesus, Engel 14. Christlich-Islamischer Dialog"Liebe ist die Zerreißung der Schleier und die Enthüllung der Geheimnisse"
--- Al-Qusairi (Iran, 11. Jh.) Aus: Geduld bringt Frieden. Mystische Losung für jeden Tag ... Frankfurt/M.: Insel 1994 (4.3.)--- Lektüre: Was jeder vom Islam wissen muss, S. 261-299![]()
- Aspekte des islamischen Glaubens -
Beiträge führender französischer Islamwissenschaftler
(Open Edition):
Aspects de la foi de l'Islam.
Facultés universitaires Saint-Louis Bruxelles 1985, 241 pp.
- Evangelii Gaudium.
Apostolisches Schreiben von Papst Franziskus (25.11.2013)
Dialog mit dem Islam Nr. 252-253
- Menschenbild in der Bibel, bei Martin Luther
und im Islam - eine christliche Sicht (Textmaterial, Dez. 2015)
- Karl-Josef Kuschel: Die Bibel im Koran.
Grundlagen für das interreligiöse Gespräch
Ostfildern: Patmos 2017, 672 S. - Stefan Leder (Hg.): Schrift - Offenbarung - Dogma
im christlich-muslimischen Dialog.Katholische, protestantische und muslimische Theologen im Dialog
mit Theologen der Azhar Universität Kairo. Regensburg: Pustet 2016, 264 S.
Inhaltsverzeichnis und Leseprobe: hier - Die Deutschen und die Ablehnung des Islam
(zu einer Studie der Universität Münster vom Herbst 2010) - Anja Middelbeck-Varwick:
Cum Aestimatione. Konturen einer christlichen Islamtheologie.
Münster: Aschendorff 2017, 387 S.
(Ein-Sichten, 28.09.2018) - Mehmet Soyhun, islamischer Theologe (Dortmund)
Thematisches Protokoll: Christlich-islamischer Dialog - Theologisches Forum Christentum - Islam:
Dialog und Auseinandersetzung
in den beiden monotheistischen Religionen
Schwerpunkt: Kritik, Widerspruch, Blasphemie (2017)
- Positionspapier der EKD zum christlich-islamischen Dialog (24.09.2018)
- „Willkommen in der evangelischen Kirche“--- "Willkommen in der evangelischen Kirche" - so lautet der Titel einer Broschüre, die die Evangelische Kirche von Westfalen herausgegeben hat. Das kleine Heft gibt es als türkisch-deutsche und als arabisch-deutsche Ausgabe. Es richtet sich an muslimische Besucher aus den entsprechenden Ländern, die zu Gast in evangelischen Kirchen sind. 19 kurze Beiträge erklären einfach, aber präzise in Wort und Bild, was in einer Kirche zu sehen ist: Altar, Kreuz, Kanzel, Taufstein, aber auch Kerzen, Klingelbeutel, Orgel oder Glocken.
- Türkisch-deutsche Ausgabe (pdf)
- Arabisch-deutsche Ausgabe (pdf)
15. Islam und Moderne (Bilanz)Halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir.
Suchst du ihn anderswo, du fehlst ihn für und für.
Angelus Silesius(1624-1677)
Aus: Geduld bringt Frieden. Mystische Losung für jeden Tag ... Frankfurt/M.: Insel 1994 (7.2.)
II. Ergänzende Materialsammlung
Islamische Eschatologie - Leben, Tod, Sterben und Paradies im Islam
Koran und Hadithe:Jenseitsvorstellungen der Religionen, Kap. 6: hier - Sebastian Günther / Christian Mauder:Roads to Paradise: Eschatology and Concepts of the Hereafter in Islam
(2 vols). --- Leiden (NL): Brill 2016
- Was sagt die Kirche zum Islam?
Ev. Kirche von Westfalen zu Dialog, Kopftuch, Ramadan (2015/2016) - Islamische Gepflogenheiten
![]() Christoph Peter Baumann und Sarah Hess-Hurt:
Christoph Peter Baumann und Sarah Hess-Hurt:
Islam in Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Basel: Manava 2014, 164 S.Im Islam hat die Höflichkeit eine wichtige ethische Qualität im Umgang mit Menschen. Die Begrüßungsgestik ist aber weltweit von Land zu Land unterschiedlich. In islamischen Ländern gibt es sogar lokale und regionale Unterschiede.
Mit der sachlichen und neutralen Einführung in das religiöse Leben von Muslimen in der Region Basel wollen die Autoren einerseits der diffusen Angst vor dem Islam entgegenwirken sowie Missverständnisse, Halbwahrheiten und von den Medien geschürte Vorurteile aus dem Weg räumen.
- Bild und Bilderverbot im Islam
--- Silvia Naef:Bilder und Bilderverbot im Islam.
Vom Koran bis zum Karikaturenstreit. München 2007 - Alkohol im Islam:
Rudolph (Rudi) Matthee:
Alcohol in the Islamic Middle East. Ambivalence and Ambiguity.Academia.edu, aus Oxford Journals, 21.04.2014, p. 100-125
Islamische MYSTIK - ein Thema für den Religionsunterricht?
Literaturbericht, Textbeispiele, Literaturauswahl
Iserlohner Con-Texte Nr. 15 (ICT 15), 2009 (neu bearb.), S. 71-100
- Abdoldjavad Falaturi (1926 - 1996):
Der Islam - Religion der rahma, der Barmherzigkeit
In: A. Falaturi / J.J. Petukowski / W. Strolz (Hg.): Universale Vaterschaft Gottes. Begegnung der Religionen. Freiburg u.a.: Herder 1987, S. 67-87, wieder abgedruckt in: "Der Islam im Dialog".
Aufsätze von Prof. A. Falaturi. Hamburg: Islamwissenschaftliche Akademie 1996, S. 98-120
- Jesus im Koran - islamische Sichtweisen im Dialog
- SCHARIA und islamische Rechtstraditionen
- Islamische Vorstellungen von GERECHTIGKEIT und FRIEDEN
(Hakan Altinay in Open Democracy, 14.06.2016) - Bertelsmann-Stiftung: Religionsmonitor:
Sonderauswertung Islam - Januar 2015 - Ein dauerndes Problem: Schleier, Kopftuch, Burka
- Islam, Saudi-Arabien und die Ablehnung des Terrorismus (NZZ , 13.04.2010)
- ZDF-Forum am Freitag:
Informationen und Gespräche zum Islam - Liberal-Islamischer Bund: Religionsverschiedene Ehen im Islam
III. Weitere Literaturhinweise III.1 Vertiefende Literatur zum Thema
Islam in Europa, Säkularismus und Demokratie (Suhrkamp-Verlag)| »Jetzt, nach dem Schock über das Gemetzel in der Redaktion von Charlie Hebdo, ist der Moment gekommen, um Mut zum Nachdenken zu finden. Jetzt und nicht später, wenn sich die Dinge legen, wie uns die Freunde billiger Weisheiten zu überzeugen suchen: Die Herausforderung besteht genau darin, den Akt des Denkens mit der Hitze des Augenblicks in Einklang zu bringen.« Slavoj Žižek |
|
|
|
|
|
![]()

![]()